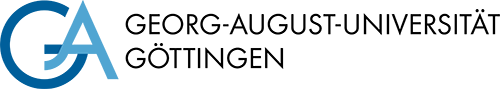Auch wenn alle Universitätsstädte sicherlich Ähnlichkeiten haben, lebt es sich in Fayetteville doch anders als in Göttingen. In der heutigen Folge meiner Auslandssemester-Reihe erzähle ich euch von neun Besonderheiten des Campuslebens in den USA – und einige Dingen, an die ich mich nicht so recht gewöhnen kann.
Campus

An der University of Arkansas gibt es keine Rivalität zwischen Nord- und Z-Campus – sondern alle studieren auf demselben Campus, der auf einem Hügel gleich neben der Innenstadt liegt und deshalb auch liebevoll „The Hill“ genannt wird. Zwar gibt es einige Büros, die weiter abseits liegen, aber das hauptsächliche Uni-Leben spielt sich auf dem Hill ab. Hier studieren Chemiker*innen neben Architekt*innen, Literaturwissenschaftler*innen neben BWLer*innen und angehende Anwält*innen neben Pflanzenwissenschaftler*innen. Der Campus selbst ist riesig, die architektonisch nicht gerade bescheidenen Gebäude sind durchsetzt von großzügigen Grünflächen und auf den Wegen tummeln sich zwischen 10 und 17 Uhr die Studierenden.
Der Herbst ist hier so etwas wie die Kirschblüte in Göttingen: Kaum färben sich die Blätter und die goldene Oktobersonne kommt raus, stürmen die Studierenden den Campus und machen Fotos von der Farbenpracht für ihr Instagram. Und wer könnte es ihnen verübeln? Schließlich ist der Blick auf den herbstlichen Campus und die umliegenden Berge wirklich extrem schön.
Essen
Wer hätte es gedacht, aber ich vermisse die Turmmensa inniglich. Denn in den USA gibt es kein vergleichbares Mensa-System. Zwar gibt es Dining Halls, diese haben aber mehr von einer Fünf-Sterne-All-Inclusive-Verpflegung als von Kantine. Für 10 Dollar gibt es hier verschiedenste Buffets, Salatbars, eine Sandwich-Station, diverse Nachtische und Getränke inklusive. Also sicherlich ein passables Preis-Leistungsverhältnis, aber für jeden Tag dann doch etwas teuer. Das Gute: In einer der Dining Halls zahlen Graduate Students (also Studierende im Master oder PhD) freitags nur 7 Dollar – eine Gelegenheit, die ich und andere Austauschstudierende regelmäßig ausnutzen, um uns einmal die Woche richtig satt zu essen.
Abgesehen davon ist die Auswahl eher enttäuschend: Der amerikanische Uni-Campus ist durchsetzt von privaten Fast-Food-Unternehmen, bei denen man für eine gesamte Mahlzeit auch gut und gerne schonmal 10 Dollar los wird – ganz abgesehen davon, dass die Ernährung davon auf Dauer wohl kaum gesund ist. Es gibt jedoch auch einige Highlights der Campus-Gastronomie; ein Salatrestaurant, das nur Gemüse verwendet, das auf dem Campus angebaut wurde, kleine Cafés mit lokal geröstetem Kaffee, der den Göttinger Blümchenkaffe ziemlich alt aussehen lässt.
Ansonsten ist free food der Schlüssel zum Glück: Bei universitären Events gibt es in der Regel etwas zu essen. Besonders als Graduate Student lernt man schnell, diese Gelegenheiten auszunutzen, ist Einkaufen und Kochen doch auch verhältnismäßig teuer. Und wenn es gegen Ende des Monats mal besonders knapp wird, gibt es in der Graduate Student Lounge ein Regal mit Fertig-Mahlzeiten, die man sich kostenlos nehmen darf.
Sport

Sport ist das Zentrum des amerikanischen Campuslebens. In die College-Mannschaften wird in den USA ordentlich Geld gepumpt. Es gibt für ungefähr jede Sportart ein Team, natürlich insbesondere für die hierzulande beliebtesten: Football, Baseball und Basketball.
Footballspiele sind sicherlich eine spannende kulturelle Erfahrung und besonders aufgrund des ganzen Brimboriums drumherum (Feuerwerk, Cheerleader, Marching Band, …) definitiv sehenswert. Das Spiel selbst ist allerdings zum Einschlafen. Mehrere Versuche zuvorkommender Freund*innen, mir die Regeln zu erklären, schlugen fehl und ich habe immer noch keine Ahnung, was auf dem Feld vor sich geht. Dadurch, dass das Spiel immer wieder unterbrochen wird, kommt es zu wenig Dynamik und es zieht sich über Stunden. Hinzu kommt, dass die Razorbacks, das Football-Team der U of A, gnadenlos schlecht sind und diese Saison nur zwei Spiele gewonnen haben. Der Coach (der für seinen Job jährlich ein Millionen-Gehalt bekommt) wurde gerade gefeuert. Wesentlich unterhaltsamer (und schneller vorbei): Basketball!
Kultur

Kulturell hat Fayetteville und Umgebung einiges zu bieten. Nicht weit entfernt von der Uni liegen das berühmte Crystal Bridges Museum for American Art und das kürzlich eröffnete The Momentary; beides sehenswerte Orte für amerikanische Kunst von indigen bis gegenwärtig. Aber auch die Stadt selbst hat eine vielseitige Kulturszene: unzählige Galerien, mehrere Theater, Lyrik-Lesungen, Konzerte, Drag Shows – langweilig wird es hier nicht wirklich.
Clubs und Organisationen
Die University of Arkansas hat eine große und sehr aktive Gemeinschaft an internationalen Studierenden. Für Internationals ist hier immer was los, ob organisierte Ausflüge, kulturelle Präsentationen oder die Vermittlung von Freundschaftsfamilien, mit denen zusammen man die amerikanische Kultur kennenlernen kann. Und auch davon abgesehen gibt es für so ziemlich jedes erdenkliche Interesse eine Studierenden-Organisation, in der man sich engagieren kann.
Nachtleben

Der amerikanische Umgang mit Alkohol ist von einer seltsamen Doppelmoral geprägt: Im öffentlichen Raum ist Alkohol strengstens verboten. Wer mit einem „open container“, also etwa einer Bier-Dose, die nicht durch irgendetwas verhüllt ist, auf der Straße erwischt wird, bekommt eine saftige Geldstrafe. Die Campuspolizei kontrolliert Studierende, die betrunken wirken, wird man erwischt, kann das schnell auch mal zu einer Nacht im Gefängnis und, im Fall von internationalen Studierenden, augenblicklichem Visa-Entzug führen. Drinnen hingegen gibt es kaum Hemmungen gegenüber Alkohol-Konsum: Dieser ist zwar erst ab 21 erlaubt, doch auch jüngere Studierende finden Mittel und Wege zum Rausch.
Das Herz des Nachtlebens ist die Dickson Street, auf der sich Bars und Clubs aneinanderreihen, Freitag und Samstag quellen die Bürgersteige hier über, wenn die Studierenden um die Häuser ziehen. Die Bars sehen aus wie in Europa, nur das Ausgehen selbst gestaltet sich anders: Statt es sich in einer Bar gemütlich zu machen, ist das Bar Hopping der modus operandi. Abseits des Trubels gibt es einige ruhigere Bars, die ihr eigenes Craft Beer brauen, das im Gegensatz zum Großteil des amerikanischen Biers tatsächlich Geschmack hat.
Greek Life

Ein großer Teil des amerikanischen Unilebens sind Verbindungen, die ein wenig anders funktionieren als in Deutschland. In den USA gibt es Sororities für Frauen und Fraternities für Männer. Von beiden gibt es unzählig viele, die sich alle mit einer willkürlichen Kombination aus griechischen Buchstaben (Kappa Beta, Phi Gamma Alpha, Delta Delta Delta) bezeichnen, weshalb der ganze Spaß üblicherweise „Greek Life“ genannt wird. Wie mir versichert wurde, unterscheiden sich alle Verbindungen in ihrer jeweiligen Ausrichtung, von außen lässt sich das jedoch kaum erkennen. Alle besitzen sie am Rand des Campus herrschaftliche Villen, in denen einige Mitglieder wohnen. Die Häuser der Sororities sind stets mit irgendeiner bonbonfarbenen, glitzrigen Deko geschmückt. Die Mitgliedschaft in einer Verbindung ist teuer, dementsprechend wenig divers sind ihre Zusammensetzungen.

Zu Beginn des akademischen Jahres müssen Bewerber*innen einen komplexen Bewerbungsprozess durchlaufen, nachdem sie hoffentlich Eintrittsangebote mindestens einer Verbindung bekommen. Die Entscheidung findet am sogenannten Bid Day statt, an dem in einer aufwendigen Zeremonie auf dem Campus die neuen Mitglieder T-Shirts enthüllen, auf denen steht, für welche Sorority sie sich entschieden haben. Für das ganze Spektakel reist die gesamte Familie an, sind Verbindungen doch auch eine Familientradition. Das Greek Life ist zeitaufwendig: Jede Woche steht irgendein neuer Nonsens an, für den Deko gebastelt werden muss, ständig muss bei Pep Rallyes getanzt und gechantet werden und das Sorority-T-Shirt muss regelmäßig in die Wäsche, damit es dann wieder stolz auf dem Campus getragen werden kann. Für Undergrads ist es jedoch eine willkommene Gelegenheit, um andere wasserstoffblonde Mädels und Undercut-Dudes kennenzulernen. Offiziell sprechen sich die Verbindungen deutlich gegen Hazing (demütigende Aufnahmerituale) aus, was hinter den Kulissen abgeht, weiß jedoch niemand. Jedenfalls kursieren auf dem Campus zahlreiche Gerüchte über sexuelle Übergriffe auf Frat Partys.
Mode
Auf dem Campus scheint so etwas wie ein unausgesprochener Dress Code zu herrschen. Besonders die Studentinnen tragen im Sommer alle dasselbe: ein übergroßes T-Shirt, eine kurze Shorts und Sneakers. Für den Winter ziehen sie noch einen Pullover über (keine Jacke, denn Amerikaner*innen bewegen sich grundsätzlich nur zwischen Auto und Eingangstür an der frischen Luft) und tauschen die Shorts gegen Leggings oder (ja wirklich) Schlafanzughose. Insgesamt ist das Leben legerer; kaum vorstellbar, dass hier jemand eine Vorlesung im Anzug hält. Fast alle Studierenden besitzen außerdem das Uni-Merchandise, rote T-Shirts, Pullis und Mützen mit dem Uni-Maskottchen, dem ubiquitären Wildschwein, darauf. Und auch ich, das muss ich zugeben, besitze inzwischen einen Schweine-Pullover.
Befremdliches
Die Unterschiede zwischen dem europäischen und dem US-amerikanischen Uni-Alltag sind nicht wirklich gravierend. Dennoch gibt es einige Dinge, die auch nach mehreren Monaten Leben in den USA gewöhnungsbedürftig bleiben. Allen voran: die Normalität von Waffen. Es ist kein Geheimnis, dass die USA ein enormes Problem mit Waffengewalt haben und die Waffenlobby eifrig daran arbeitet, strengere Gesetze zu verhindern. Letztes Jahr wurde beschlossen, dass Waffen in Arkansas auch auf dem Campus getragen werden dürfen – solange sie nicht direkt sichtbar sind. Zwar habe ich bisher noch niemanden mit Waffe umherlaufen sehen, aber die Vorstellung, dass theoretisch jede*r meine*r Kommilitonen*innen eine Pistole in seinem Rucksack haben könnte, hinterlässt dennoch ein mulmiges Gefühl. Erst recht, wenn man einmal die Waffenabteilung bei Walmart gesehen hat und weiß, wie unkompliziert sich dort eine Schusswaffe besorgen lässt.
Auch befremdlich für Europäer*innen ist der amerikanische Umgang mit der Umwelt. Überall an der Uni wird mit Pappbechern und Plastik-Verpackungen nur so um sich geschmissen. Nur die wenigsten Studierenden laufen zum Campus oder fahren mit dem Bus oder demFahrrad. Stattdessen nehmen die Amerikaner*innen lieber das Auto – auch wenn das bedeutet, für die Parkplätze rund um die Uni bezahlen zu müssen.
Doch trotz aller Irritationen ist mein Ausflug ins US-amerikanische Campusleben eine tolle Erfahrung. Und es wäre ja auch schade, wenn ich mich nicht darauf freuen könnte, bald wieder in der Turmmensa bei einem 3-Euro-Mittagessen ganz ohne Plastikverpackungen sitzen zu können.